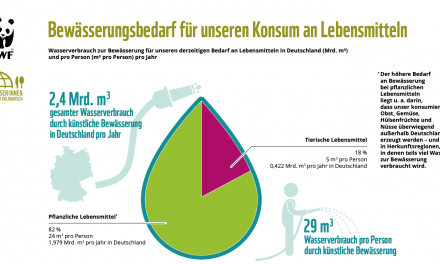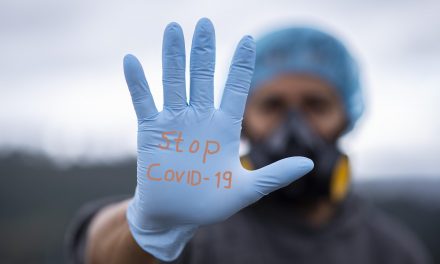Charlie, du arbeitest im Team Metaverse Technologies bei PwC in London. Was ist deine Rolle in diesem Team?
Als Metaverse-Team beschäftigen wir uns mit verschiedenen Technologien, die das Eintauchen und gemeinsame Erleben in der realen und virtuellen Welt ermöglichen. Unser Team besteht aus kundenorientierten Strategen, kreativen Experience Designern, 3D-Asset-Buildern und Game-Engine-Entwicklern, die neue Konzepte und Erlebnisebenen für interne Zwecke und für unsere Kunden entwerfen und testen. Wir helfen unseren Kunden, die Bedeutung und Möglichkeiten des Metaverse für das jeweilige Unternehmen zu verstehen und zu bewerten und das Geheimnis dahinter zu entschlüsseln.
Damit sind wir schon bei der Frage: Was ist eigentlich das Metaverse?
Im Grunde weiß das niemand so recht, denn jeder hat seine eigene Definition dafür. Vor allem nicht, was es eines Tages sein wird. Wenn ich es jemandem erklären müsste, der noch nie davon gehört hat, würde ich sagen: Es ist die Evolution des Internets und der Art und Weise, wie wir es erleben und darin agieren. Als das Internet ins Leben gerufen wurde, nannte man es „Information Superhighway“, und natürlich war es nicht das Internet, wie wir es heute kennen. Es entwickelte sich vom informationsgesteuerten Internet zum sozial gesteuerten Internet – eine neue Art, wie Menschen online miteinander interagieren können. In gleicher Weise wird das Metaverse in zehn bis 15 Jahren nicht mehr das sein, was es heute ist. Die analoge und die digitale Welt werden mehr und mehr miteinander verschmelzen.
Wir haben uns eine Reihe ehrgeiziger Ziele gesetzt, von denen wir glauben, dass wir sie in Zukunft erreichen können, um diese wunderbare digitale Welt für die Wirtschaft nutzbar zu machen. Das bedeutet nicht, dass jeder heute im Metaverse aktiv sein und dort Hunderte von Millionen Pfund investieren muss. Aber Unternehmen können frühzeitig einen Grundstein legen, um für die Zukunft gerüstet zu sein, indem sie schon heute ein bisschen damit experimentieren.

Halb Österreicher, halb Amerikaner, wuchs Charlie Neuner in Großbritannien und Belgien auf. Seine beruflichen Erfahrungen erstrecken sich von der Arbeit an einer VR-Unterhaltungsplattform für einen großen Fernsehsender bis hin zur weltweiten und branchenübergreifenden Beratung von Kunden zu immersiven Lösungen für die Steigerung ihres Geschäftserfolgs im Metaverse-Team der Unternehmensberatung PwC.
Wie lässt sich im Metaverse Geld verdienen?
Wir sehen bereits die ersten Anzeichen dafür, welche Summen die Menschen bereit sind, für ihre digitale Identität auszugeben. Jeder, der Kinder hat, weiß das: Sie stecken einen großen Teil ihres Taschengeldes in diese virtuellen Welten und Spiele – Roblox, Fortnite und so weiter. Viele dieser Plattformen sind gemeinschaftsgetrieben und -orientiert. Sie verfügen über eine „Creator Economy“ – ein Geschäftsmodell, das es Schöpfern und Influencern ermöglicht, ihre Aktivitäten auf diesen Plattformen zu monetarisieren. Allein Fortnite macht jedes Jahr etwa fünf Milliarden Dollar Umsatz, und ein großer Teil davon basiert auf dem Verkauf so genannter „Skins“ – virtueller Kleidung für die Avatare.
Wenn die Leute also bereit sind, so viel Geld für etwas auszugeben, das außerhalb des Spiels keinen Wert hat und verschwinden würde, wenn Epic Games eines Tages beschließt, das Spiel zu schließen, was passiert dann, wenn wir eine hybride Welt schaffen, in der man etwas kauft, das man in die reale Welt mitnehmen oder aus dem man den Wert extrahieren kann, wenn es dezentralisiert ist?
Was für Produkte könnten das sein?
Nike hat im vergangenen Jahr mit dem digitalen Verkauf von NFT-Tokens fast 200 Millionen US-Dollar eingenommen. Etwa 100 Millionen aus dem Erstverkauf, weitere 100 Millionen aus Lizenzgebühren durch einen in die Blockchain eingebetteten Smart Contract im Falle des Weiterverkaufs. Es ist wie bei analogen Nike-Schuhen: Sie kosten anfangs 100 Euro und werden für 500 Euro weiterverkauft, weil die Stückzahl begrenzt und die Nachfrage hoch ist. Im Metaverse kann Nike Geld verdienen, ohne dass es dafür einen Aufwand braucht.
Ist das Metaverse wirklich schon so groß? Es gab auch einen kurzen Hype um die virtuelle Welt „Second Life“, aber davon spricht heute kaum noch jemand …
Second Life war wohl einfach ein bisschen zu früh dran. Übrigens gibt es dort tatsächlich immer noch viele täglich aktive Nutzer. Aber der Hauptunterschied zum Metaverse besteht darin, dass sich die Demografie verändert hat, dass es einen besseren Zugang zum Internet gibt, dass die Rechenleistung rapide zugenommen und die Technologie sich weiterentwickelt hat. Allein Roblox hat mehr als 60 Millionen täglich aktive Nutzer. Das ist verdammt viel. Und ja, viele von ihnen gehören der jüngeren Generation an. Aber natürlich ist das Metaverse noch nicht Mainstream.

Über den Verkauf von Produkten hinaus – warum sollten sich Marken im Metaverse engagieren?
Marken sollten dort sein, wo ihre Kunden sind. Um die junge Zielgruppe zu erreichen, muss man dort sein, wo sie ist – und das ist spätestens seit Covid, aber auch schon vorher, die Online-Sphäre, in der es mindestens genauso wichtig ist, wer und wo man ist und was man tut wie in der analogen Welt. Also auch, welche Marken man bevorzugt und konsumiert. Die digitale Identität.
Aber was ist die Psychologie dahinter? Warum treffen sich Menschen lieber im Metaverse als im echten Leben?
Die Menschen gehen dorthin, wo sie ihre Freunde treffen und es ein Gefühl der Gemeinschaft gibt. Die Art, wie man im Metaverse vielfältige Erfahrungen machen kann, fasziniert sie. Die Bandbreite der Möglichkeiten ist einfach exponentiell größer als in der analogen Welt: eine endlose Spielwiese, auf der man Dinge mit anderen Menschen erleben kann, ohne den Schreibtisch zu verlassen – mit Menschen, die man vielleicht in der Mittagspause noch in echt gesehen hat oder solchen, die sich am anderen Ende der Welt befinden. Diese Verschmelzung der Welten ist das wirklich Spannende – auch für die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen.
Wie kann zum Beispiel ein Gastgewerbeunternehmen hier mitmachen? Einen Burger kann man nicht virtuell essen.
Das ist richtig. Deshalb hat es das Gaststättengewerbe etwas schwerer als ein Sportschuhhersteller, der einen virtuellen Laden mit einem einzigartigen Einkaufserlebnis einrichten und dort sowohl virtuelle als auch analoge Produkte verkaufen kann.

Aber es gibt Möglichkeiten: Die amerikanische Fast-Food-Kette Wendy’s zum Beispiel ist im Metaverse sehr aktiv, wenn es um Marken- und Community-Aufbau geht. Die steigern damit tatsächlich die Besucherzahlen und den Umsatz in ihren realen Restaurants. Einige Unternehmen experimentieren auch mit Treueprogrammen, bei denen virtuell gesammelte Token in der realen Welt eingelöst werden können. Das NFT-Belohnungsprogramm von Starbucks ist sehr interessant, da es den Kunden ermöglicht, digitale Sammelobjekte zu erwerben, die den Zugang zu neuen Vorteilen und besonderen Kaffeeerlebnissen freischalten.
„Die analoge und die digitale Welt werden mehr und mehr miteinander verschmelzen.„
Generell wird die Blockchain-Technologie die Art und Weise, wie wir für Waren und Dienstleistungen bezahlen, verändern – auch innerhalb von Lieferketten, und wir könnten endlos über die Möglichkeiten dieser Technologie an sich sprechen! Ein weiterer Faktor, wie das Gastgewerbe das Metaverse gewinnbringend nutzen kann, ist die Schulung des Personals. Dabei kann es sich sowohl um Soft Skills als auch um Hard Skills handeln – es gibt hier einen sehr großen B2B-Spielplatz, wenn es um die Befähigung von Arbeitskräften geht (Schulung, Rekrutierung, Onboarding, Fernunterstützung usw.), der einen Mehrwert in Form von Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen bietet.
Ist das Metaverse nur etwas für die großen Marken? Oder sollte jedes Restaurant mittelfristig einen Zwilling im Metaverse haben, um mit seinen Gästen in Kontakt zu treten?
Derzeit hören wir viel von den großen Unternehmen, die sich als erste im Metaverse ausprobieren, weil sie die Ressourcen haben. Dennoch gibt es auch für kleinere Unternehmen eine Chance, wenn sie ihre Community anzapfen können. Für kleinere Unternehmen könnte es sinnvoll sein, sich regional im Metaverse zu verankern, indem sie beispielsweise eine Plattform für lokale Gamer oder sogar einen Fußballverein anbieten. Die Menschen, die diese Mannschaft unterstützen, suchen die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten – und treffen diese in einer – virtuellen oder realen – Kneipe oder Sportsbar. So bringen Sie eine Gemeinschaft aus der virtuellen in die reale Welt. Aber jeder sollte sich genau überlegen, wie und wo er investiert, denn es muss aus Sicht der Gäste nachvollziehbar sein.

Was bedeutet das Metaverse für die Zukunft der Küchen- oder Restaurantplanung?
Entwerfen, Bauen, Betreiben physischer Systeme – was auch immer Sie vorhaben, Sie können es in einer VR- oder immersiven Umgebung tun und die Erfahrung mit allen Beteiligten teilen. Im realen Leben ist es oft schwierig, die richtigen Leute vor Ort zusammenzubringen. Ein virtueller Zwilling der geplanten Küche oder des Restaurants ermöglicht unkomplizierte Treffen in der virtuellen Welt, um Dinge zu präsentieren, zu überprüfen oder auszuprobieren.
Oder Reparaturen: Bevor Sie einen erfahrenen Techniker zur Wartung einer Kaffeemaschine losschicken, kann er einem Mitarbeiter vor Ort über eine VR-Brille Anweisungen geben, was zu tun ist. Der Techniker repariert dann 20 Maschinen am Tag statt nur einer, was enorme Ressourcen und Emissionen spart. Es gibt so viele verschiedene Anwendungsfälle für die Prozessoptimierung, die auch im Gastgewerbe oder in der Planung sehr nützlich sein können.
„Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um die Ergänzung von analogen Erlebnissen durch digitale Erlebnisse.„
Werden wir uns also in Zukunft nur noch online treffen und konsumieren?
Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um die Ergänzung von analogen Erlebnissen durch digitale Erlebnisse. In Zukunft werden Kommunikation und Einkaufen parallel über viele verschiedene Kanäle und Geräte laufen. Nur weil wir ein VR-Headset nutzen, heißt das nicht, dass Handy oder Laptop überflüssig werden. Wichtig ist, dass wir die Menschen mitnehmen, denn letztlich sind es die Verbraucher und Kunden, die die Entwicklung vorantreiben werden.
Irgendwann wird jede Organisation im Metaverse vertreten sein. Einige werden sie für die Bildung nutzen, andere für Transaktionen, wieder andere für den Aufbau von Gemeinschaften.
Was sagst du Leuten, die Angst vor dieser Entwicklung hin zu immer mehr Virtualität haben?
Natürlich gibt es eine große ethische Verantwortung dafür, wie wir miteinander umgehen und was mit den Daten geschieht. Damit muss man sich als Unternehmen auseinandersetzen. Bei allen Dingen, die große Chancen bieten, gibt es auch immer große Risiken – deshalb haben wir mit unseren Kunden einen verantwortungsvollen Metaverse-Rahmen entwickelt.

Was genau sind die Risiken? Was könnte passieren, wenn im Metaversum tatsächlich mal etwas schief geht?
Es gibt eine ganze Reihe von Risiken, so wie sie auch im heutigen Internet bestehen. Einige davon betreffen die digitale Identität, das heißt, es muss sichergestellt werden, dass die Menschen wirklich die sind, die sie vorgeben zu sein. Besonders in Zeiten, in denen KI es möglich macht, dass Bots alle möglichen Dinge mit fremden Stimmen sagen.
Wir brauchen auch eine sichere Infrastruktur für Zahlungen. Digitale Identitätsprüfungen, Geldbörsen und Schlüssel werden uns dabei helfen.
Ein weiteres Problem könnte sich für die psychische Gesundheit der Menschen ergeben, die sich über einen längeren Zeitraum in diesen Räumen aufhalten. Was macht es mit uns, wenn wir stundenlang Headsets tragen? Könnte es sogar eine positive Wirkung haben? Es gibt eine Menge wichtiger Fragen, die beantwortet werden müssen.
Was könnten solche positiven Auswirkungen sein?
Wir haben eine große Studie mit dem britischen National Health Service durchgeführt, um herauszufinden, welche Vorteile der Einsatz dieser Art von Technologie für das Gesundheitswesen hat. Mit erstaunlichen Ergebnissen: Sie wirken sich am positivsten auf die Ausbildung des medizinischen Personals aus, gefolgt von der psychischen Gesundheit und dem Wohlbefinden der Patienten. Auch für die Physiotherapie und die Schmerzbehandlung werden sie einen entscheidenden Wandel bewirken. Es gibt bereits Geräte, die bei der Parkinson-Krankheit helfen.
Zusammenfassend würde ich sagen: Ja, es gibt Risiken, aber es gibt auch enorme Möglichkeiten, wie wir das Leben der Menschen durch Technologie verbessern können.
Dieses Interview erschien zuerst im Magazin 2023 des FCSI Deutschland-Österreich e.V. Das vollständige Magazin finden Sie hier: https://fcsi.de/magazin/2023/
Eine Zusammenfassung des FCSI Round Tables des FCSI im Oktober 2023 in Berlin lesen Sie hier: https://www.presstaurant.de/fcsi-convention-2023_mensch-community

Barbara Schindler entdeckte schon früh ihre Lust am Schreiben. Mit 16 stand für sie fest: Ich will das Geschichtenerzählen zum Beruf machen, werde Journalistin. Mit einem Studium der Musikwissenschaft, Anglistik und Romanistik orientierte sie sich in Richtung Feuilleton, landete dann aber nach einigen Umwegen beim Fachjournalismus mit Schwerpunkt Gastronomie. Seither berichtet sie – zunächst als festangestellte Redakteurin bei der Fachzeitschrift Food-Service, seit Sommer 2018 freiberuflich – über alle Aspekte der Branche. Barbara Schindler ist verheiratet und lebt in Frankfurt am Main.