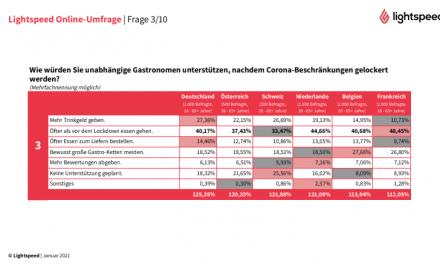Im ÜberQuell entscheidet das bierverliebte Team gemeinsam, was gebraut wird: v.l.: Torben Sturhan, Vertriebsleitung, Daniel Hertrich, Marketing, Axel Ohm, Geschäftsführer, Patrick Rüther, Tina Küster, Betriebsmanager, Tobias Hess, Braumeister. Alle Fotos: ÜberQuell
Als vor gut zehn Jahren die Craft-Bier-Welle aus den USA und Südafrika nach Deutschland schwappte, erwartete manch einer eine Revolution im Land des Reinheitsgebots. „Diese Revolution ist ausgeblieben”, sagt Patrick Rüther, einer der Pioniere der Szene in Deutschland. Als Gründe nennt er unter anderem den sehr komplexen und wettbewerbsintensiven Biermarkt mit einer Vielzahl an Brauereien sowie etablierten Vertriebs- und Logistikstrukturen, die es kleinen und neuen Brauereien schwer machen. Auch die Preissensibilität der Deutschen und das insgesamt akzeptable Mindestniveau des weit verbreiteten „Industriebiers” haben dafür gesorgt, dass „die Sehnsucht nach besserem Bier hier einfach nicht so groß war wie in den USA oder Frankreich”, wie der Unternehmer erklärt, der 2013 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Axel Ohm im Restaurant „Altes Mädchen” die Idee des handwerklich gebrauten und vielfältigeren Biers nach Hamburg brachte.
Seit 2017 verwirklicht das Duo in den denkmalgeschützten „Riverkasematten” mit Blick auf die Kräne im Hamburger Hafen seine Idee einer Brauwerkstatt mit Gastronomie: Ihr „ÜberQuell” an der Elbe ist eine ganz eigene, bunt-kreative Welt im Zeichen des „Ü” und feierte kürzlich den 5. Geburtstag. Anlass, mit Patrick Rüther über den Zustand der Craft-Bier-Szene in Deutschland zu sprechen.

Patrick Rüther, Craft-Bier-Pionier und Geschäftsführer ÜberQuell.
Patrick, fünf Jahre ÜberQuell: Was macht euch erfolgreich?
Patrick Rüther: Das ÜberQuell ist vielschichtig und vielgestaltig. Ich denke dabei immer zuerst an den Standort auf St. Pauli, unser denkmalgeschütztes Gebäude mit Brauerei, Restaurant und Kneipe. Nicht unbedingt an die Marke im Supermarkt, die es natürlich auch gibt. Aber das ÜberQuell sind primär die Menschen im Restaurant, das Team mit seiner großen Bier-Leidenschaft und -Erfahrung. Anders als Fantasiebiermarken, die sich coole Rezepte und Namen einfallen lassen, aber gar nicht selbst brauen, sind wir authentisch, transparent und tragen keine große Geschichte nach vorne.
Wie hat sich euer Bier-Sortiment weiterentwickelt?
Patrick Rüther: Inzwischen haben wir acht Standard-Biere. Unser erstes, das Helle „Original” ist nach wie vor das Flaggschiff, hinzu kommen beispielsweise das Pale Ale „Palim Palim”, das „Supadupa”-IPA und das alkoholfreie „Pillepalle”. Darüber hinaus machen wir diverse Seasonals & Specials: Spring Ale, Golden Ale, Summer Whit mit Orangenzeste und Koriandersamen, das Winter Ale oder einen weihnachtlichen Julebryg nach dänischem Vorbild. Das Hamburger Franzbrötchen hat uns zu einem Imperial Brown Ale mit Zimtnoten inspiriert. Unsere neueste Kreation, das unfiltrierte Pils „Bambule”, wurde bereits als „Kellerbier des Jahres” ausgezeichnet, was uns sehr stolz macht.
Warum gerade ein Pils? Ist das nicht sehr Mainstream?
Patrick Rüther: Könnte man denken, deshalb waren wir auch zunächst mit Pils eher zurückhaltend. Aber wir haben die Erfahrung gemacht: Wer häufig krasse Biere trinkt, hat manchmal wirklich Lust auf ein einfaches Pils.
Das „Bambule” ist klar, krisp, etwas bitterer. Nicht so voluminös und weniger süß als Helles. Kurz: unkompliziert trinkbar, nicht zu craftig – ganz bewusst ein Craft Bier-Skeptiker-Pils für Einsteiger.

Entstehen denn alle ÜberQuell-Biere in eurer Brauwerkstatt?
Patrick Rüther: Wir haben in der Hamburger Hafenstraße eine relativ große, professionelle Brauanlage mit einer Kapazität von 15 hl mit entsprechenden Tanks, die schafft bis zu 2.000 hl/Jahr. Das meiste schenken wir im ÜberQuell selbst aus, ein Teil geht auch in die Bullerei, die ich gemeinsam mit Tim Mälzer betreibe. Auch Spezialitäten in kleinen Mengen stellen wir hier her, bei denen sich eine Handabfüllung lohnt. Denn in den Riverkasematten ist kein Platz für eine Abfüllanlage.
Auf einmal haben alle Zwickel, Naturtrüb oder Braumeister-Editionen im Programm, die den Anschein von ein bisschen mehr Handwerk erwecken. Diese neue Vielfalt ist ein Verdienst der Craft-Bier-Bewegung.
Größere Chargen und die Biere für den Handel braut unser Partner Schnitzelbaumer in Traunstein für uns. Dort können wir alles produzieren, was nach dem Bayrischen Reinheitsgebot erlaubt ist. Das ist nämlich noch restriktiver als in anderen Bundesländern. Es gibt dort ein größeres Sudwerk, die notwendige LKW-Logistik und eine maschinelle Flaschenabfüllung. Die Kapazitäten sind nach oben offen, wir wollen gemeinsam wachsen.

Wie beurteilst du die aktuelle Situation von Craft-Bier in Deutschland? Hattest du dir mehr erwartet, als ihr vor zehn Jahren damit gestartet seid?
Patrick Rüther: Craft-Bier ist kein geschützter Begriff, deshalb ist es schwer einzugrenzen. Ich bin überzeugt, dass Biervielfalt und Bierqualität auch in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen werden – aber ob das dann Craft genannt wird? Keine Ahnung. Die Szene ist längst bunter als nur Surfer und Jungs mit langen Bärten …
Es stimmt schon: Es gab in Deutschland definitiv nicht so eine Explosion der Thematik wie in den USA und anderen Ländern. Das wird auch nicht mehr kommen. Aber Schritt für Schritt wird das Bewusstsein für Authentizität, Handwerk und die Macher dahinter weiter wachsen.



Was sind die Gründe, dass die deutschen Bier-Fans sich nicht so sehr für Craft-Bier begeistern können?
Patrick Rüther: Für die Masse der Biertrinker in Deutschland ist Craft-Bier wohl einfach zu teuer. Sie kaufen Bier als Aktionsware im Supermarkt, also das, was gerade im Angebot ist, ohne auf die Marke zu achten. Hinzu kommt, dass es ja das Eingeständnis eines Irrtums bedeutet, wenn ich zugebe, dass ich mich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte von den Marketing-Tricks der Industrie habe blenden lassen. Das fällt vielen schwer, deshalb bleiben sie beim Gewohnten.
Das ÜberQuell sind primär die Menschen im Restaurant, das Team mit seiner großen Bier-Leidenschaft und -Erfahrung.
In den vergangenen 30 Jahren hat sich das Industriebier immer mehr in Richtung günstig und Massengeschmack entwickelt. Das hat aber niemand so richtig gemerkt, weil die geschmacklichen Veränderungen jeweils nur sehr dezent waren. Gleichzeitig ist das Deutsche Reinheitsgebot ein unfassbar effektives Marketinginstrument. Theoretisch kann man darunter fast alles machen, aber es gilt immer noch als Qualitätssiegel. Dabei stellt es nur eine gewisse Absicherung der Qualität dar und ist nicht automatisch ein Zeichen für gutes Bier. Dennoch ist das Niveau der Industriebiere hier insgesamt höher als in anderen Ländern, in denen Craft-Bier es leichter hatte.

Was ebenfalls eine Rolle spielt: Die großen deutschen Brauer sind sehr schnell auf den Craft-Zug aufgesprungen: Auf einmal haben alle Zwickel, Naturtrüb oder Braumeister-Editionen im Programm, die den Anschein von ein bisschen mehr Handwerk erwecken. Diese neue Vielfalt ist ein Verdienst der Craft-Bier-Bewegung. Vorher war das Angebot an Langeweile nicht zu überbieten.
Wie sehr haben die in Deutschland üblichen strengen Bierlieferverträge verhindert, dass Craft-Bier in der Gastronomie durchstartet?
Patrick Rüther: Der Biermarkt hierzulande ist insgesamt sehr komplex, es gibt viel Wettbewerb, hinzu kommen die Vertriebsstrukturen, die kleine Brauer benachteiligen. Ich bin kein genereller Kritiker der Gastronomie-Finanzierung durch Brauereien, denn sie hat ja auch viele Vorteile. Ohne sie hätten wir nicht diese große gastronomische Vielfalt. Und wenn ich als Brauerei einem Gastronomen 50.000 Euro gebe, damit er seinen Laden einrichten kann, darf ich natürlich auch erwarten, dass er mein Bier verkauft. Dennoch: Wenn die Gastronomen frei entscheiden könnten, wäre es leichter, bei ihnen auch mal ein neues Bier zu platzieren.

Wie positioniert sich das ÜberQuell in diesem Markt?
Patrick Rüther: Wir sehen uns als ehrliche, nette Revolutionäre von nebenan. Axel Ohm und ich sind nicht mehr die Jüngsten, rennen nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand. Wir wollen abliefern, sind aber vielleicht nicht laut genug, sondern eher hanseatisch understated. Wir machen die Dinge, weil wir sie lieben und Lust darauf haben – sogar etwas völlig Unlogisches wie eine Brauerei in ein Gebäude wie die Riverkasematten zu bauen.
Auch unser Braumeister Tobi ist kein Showman, ihm und unserem ganzen sehr engagierten Teams geht es zu allererst um Qualität. Die aktuellen Trend-Biere der Szene – NEIPAs oder Hazy IPA – sind sehr fruchtige, süße Biere, fast wie Milchshakes, obwohl der Geschmack nur durch Hopfen erzielt wird. Das ist handwerklich nicht schwierig, aber viele Brauereien feiern sich dafür. Wir können das auch, stehen aber mehr für ausgewogene Balance zwischen Malz, Hopfen, Hefegeschmack und Kohlensäure.
Wir haben keine klar definierte Mission, sondern bei uns entscheiden viele bierverliebte Menschen gemeinsam, was wir machen.
Wie eng sind eure Beziehungen in die Szene?
Patrick Rüther: Wir sehen uns als Teil der Szene, seit wir damals mit dem Alten Mädchen angefangen haben, gehören aber eher nicht zum harten Kern, sondern schauen interessiert auf diese kleine, leicht nerdige Community: Was ist dort angesagt? Machen wir das mit? Grundsätzlich versuchen wir, unsere Eigenständigkeit zu bewahren und nicht jeder Sau zu folgen, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Diese Unabhängigkeit zeichnet uns aus: Wir haben keine klar definierte Mission, sondern bei uns entscheiden viele bierverliebte Menschen gemeinsam, was wir machen. Dazu gehören dann eben auch Kooperationssude mit anderen Craft-Brauern, die Teilnahme an Festivals und vieles mehr.


Du hast angesprochen, dass der Standort in der Hafenstraße nicht ganz einfach ist ….
Patrick Rüther: Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden mit diesem tatsächlich herausfordernden Standort. Wir haben wenig Laufkundschaft und müssen die Leute gezielt zu uns locken – mit unserem Bier, der einzigartigen Location, Kunst und der neapolitanischen Pizza. Das bedeutet: immer aktiv sein und Top-Leistung bringen, aber das gilt ja eigentlich überall. Vor allem die Terrasse ist voll, sobald die Sonne scheint.
Allerdings gibt es Riesenunterschiede zwischen Winter und Sommer. Innen haben wir nur 80 Sitzplätze – da braucht das Team ein ganz anderes Mindset, um in Schwung zu bleiben. Im Winter ist der Laden trotzdem abends mindestens einmal, ab Mittwoch auch zweimal voll. Im Grunde bräuchten wir sogar mehr Platz, denn mit Pizza lässt sich kein besonders hoher Durchschnittsbon erzielen. Aber dank eigener und fremder Events wie Pub Quiz, Eisstockschießen, Firmenfeiern und Hochzeiten schaffen wir den Winter kostendeckend. Ohne Veranstaltungen ist das jedoch sehr schwer. Hier hat uns Corona hart getroffen.

Wir arbeiten außerdem in die Nachbarschaft hinein, zum Beispiel mit unserem Schulgarten auf dem Dach. Als Mitorganisatoren der Hamburg Beer Week wollen wir Craft-Bier stadtweit fördern.
Wie wichtig ist das Handelsgeschäft für ÜberQuell?
Patrick Rüther: Bierproduktion und -vertrieb für den LEH und Gastronomie sind zwei ganz unterschiedliche Geschäfte. Grundsätzlich sehen wir den Handel als Wachstumsfeld. Für Axel und mich persönlich ist ein laufendes Restaurant aber immer wichtiger als das, was außerhalb passiert. Wir haben einfach die Gastro-DNA. Gastronomie braucht Emotionen und ganzen Einsatz – im LEH geht es deutlich nüchterner zu. Wir bemühen uns, die richtigen Menschen für den jeweiligen Bereich finden.
Und wie läuft das Geschäft mit anderen Gastronomen?
Patrick Rüther: Dafür braucht man wieder andere Leute, jemanden, der beispielsweise gerne nachts arbeitet. Es ist sehr beratungs- und zeitintensives Geschäft mit hohem Einsatz pro verkauftem Hektoliter und wird wie gesagt durch die Bierbindung vieler Betriebe erschwert. Alle großen Brauereien haben inzwischen Biere im Sortiment, die in Richtung Craft/Handwerk gehen und die Nachfrage nach etwas Besonderem befriedigen.
Da ist einfach relativ wenig Bedarf für zusätzliche Produkte von außerhalb, zumal Gastronomen es gewohnt sind, dass Brauereien ihnen die Logistik einfach machen. Aber wir bleiben ganz bestimmt dran!


Barbara Schindler entdeckte schon früh ihre Lust am Schreiben. Mit 16 stand für sie fest: Ich will das Geschichtenerzählen zum Beruf machen, werde Journalistin. Mit einem Studium der Musikwissenschaft, Anglistik und Romanistik orientierte sie sich in Richtung Feuilleton, landete dann aber nach einigen Umwegen beim Fachjournalismus mit Schwerpunkt Gastronomie. Seither berichtet sie – zunächst als festangestellte Redakteurin bei der Fachzeitschrift Food-Service, seit Sommer 2018 freiberuflich – über alle Aspekte der Branche. Barbara Schindler ist verheiratet und lebt in Frankfurt am Main.